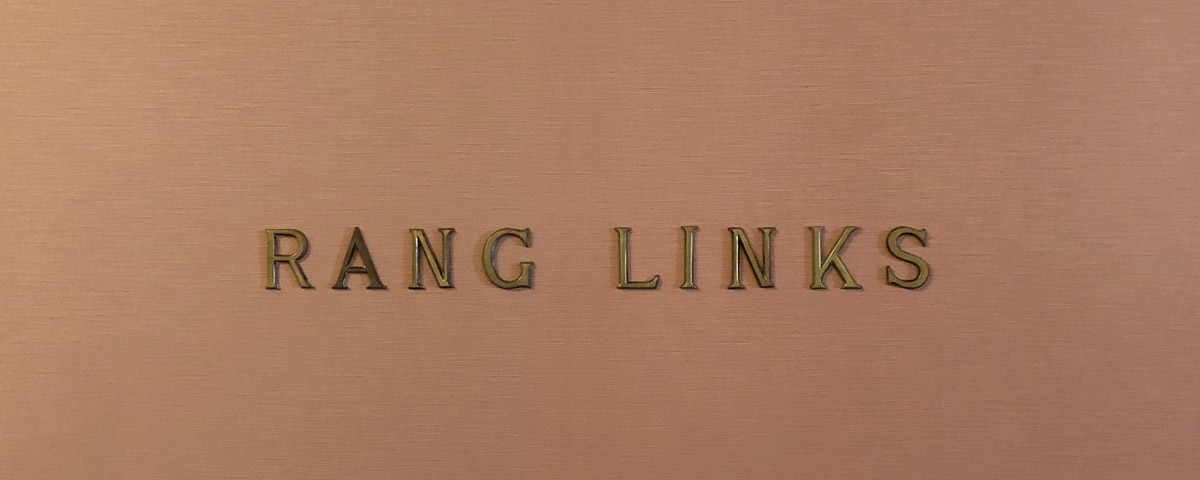
Großes Festspielhaus, Salzburg (Detail).
© Thomas Prochazka
Wolfgang Amadeus Mozart:
» Mitridate, re di Ponto «
Salzburger Festspiele
Von Thomas Prochazka
II.
Mozart komponierte Mitridate, re di Ponto, KV 87, auf seiner ersten Italienreise in der zweiten Hälfte des Jahres 1770. Den Auftrag erteilte Karl Joseph Graf Firmian, Statthalter Maria Theresias für die Lombardei, für die Saisoneröffnung 1770/71 des Teatro Regio Ducale in Milano. Das Libretto stammt von Vittorio-Amedeo Cigna-Santi und basiert auf der italienischen Übersetzung Giuseppe Parinis der von Jean-Baptiste Racine geschaffenen Tragödie Mithridate.
Noch bevor Leopold Mozart mit seinem Sohn am 18. Oktober in Milano eintraf, mußte der 14-jährige Komponist die Rezitative, quasi das Handlungsgerüst der neuen opera seria, liefern. Danach ging es vor Ort an die Komposition der Arien, welche die Stimmen und Vorzüge der engagierten Sänger ins beste Licht zu setzen und deren Schwächen möglichst zu kaschieren hatten. Der von Richard Wagner später verurteilte Kult um die Sänger (jene erhielten auch weitaus höhere Gagen als die Komponisten) war also kein Merkmal des Belcanto.
Weiß man um die damals geltenden Konventionen der opera seria, überrascht auch knapp 245 Jahre später noch die Vielfalt der Variationen im Aufbau der einzelnen Nummern bei gleichzeitig strikter Beibehaltung der Abfolge von Rezitativ und Arie. So setzte Mozart die Trompeten, welche eigentlich dem Herrscher (Mitridate) vorbehalten waren, bereits vor dessen Auftritt ein. Er verschob die Gewichtungen in der Dreiteiligkeit der Arien, kürzte da einen Mittelteil, änderte dort die Wiederholung des ersten Abschnittes. Kleinigkeiten nur für uns, die wir von den » Regeln « jener Zeit keine Ahnung haben.
III.
Es gilt als erstes Verdienst des Abends, dies uns Heutigen wieder ins Bewußtsein zu rücken. Adam Fischer, ohne Zweifel einer der besten Mozart-Dirigenten unserer Tage, und das Mozarteumorchester Salzburg sorgten für eine kurzweilige und effektvolle Wiedergabe der Partitur. Robert Burleigh, der am Hammerklavier saß, hatte auch die Studienleitung inne. Adam Fischer war im Vorfeld nicht müde geworden zu betonen, daß die opera seria ihres Aufbaues wegen am besten semiszenisch geboten werden solle.
IV.
Nun, schrieben wir nicht das Jahr 2025, dürfte nicht auch bei dieser Form der Wiedergabe eine (diesfalls weibliche) Trias ihr szenisches Unwesen treiben: Anstatt auf die Macht der Musik zu vertrauen, steckte Bernadette Salzmann die Sänger in nichtssagende, vielerlei Zeiten zitierende Kostüme. Weder fehlte der Herrscher-/Militärmantel für Mitridate, in den ersten Szenen — Achtung: großartige und noch nie zuvor umgesetzte Idee! — von Aspasia getragen, noch der Koffer, ohne welchen die Ankunft Ismenes, der Tochter des Partherkönigs und Verlobte von Mitridates Sohn Farnace, ja gar nicht vorstellbar wäre. Selbstverständlich trug Ismene ihren Koffer selbst. Die Idee, eine Königstochter reise mit Gefolge, erschien den für die Szene Verantwortlichen denn doch zu abwegig. (Wie sonst sollte einem durch keinerlei sonstige Vorkenntnisse geschädigten Festspiel-Event-Teilnehmer erklärbar werden, daß es sich bei Ismene um eine Reisende handelt?) Und welcher Herrscher zieht nicht schon einmal, während er seine Rückkehr besingt, die Stiefel aus, wirft sie in die Kulissen und repräsentiert seinen Staat in weißen Socken?
Ähnliche Dummheiten, allesamt von Birgit Kajtna-Wönig verantwortet, bot der Abend mehrere: Für die Arien plazierte die Regisseuse die Sänger zumeist vor dem Mozarteumorchester und damit vor dem Bühnenportal auf dem hochgefahrenen Graben; — geradeso, als böte das einfache, aber funktionelle Einheitsbühnenbild nicht genügend Spielfläche. Daß Kajtna-Wönig ihre Sänger damit der Schalltrichterwirkung des Bühnenraumes beraubte, ihnen die Arbeit erschwerte: Wen kümmert’s? Einzig Aspasia war es vergönnt, die Gift-Arie (Pallid’ombre
) vom mittig und erhöht an der hinteren Bühnenwand aufgestellten Thronsessel aus zu singen.
Mitridate zeigte seine Wut darüber, daß Farnace hinter seinem Rücken in Verhandlungen mit dem Rom Pompeus’ getreten war, indem er eine Violine zu Boden schmetterte. Später sollte noch ein Glas folgen. — Nein, wie originell.
Mara Wild gestaltete die deutschen Übertitel der von der Regisseuse eingestrichenen Textfassung. (Wenig überraschend denn auch, daß der projizierte deutsche Text nicht immer zum gesungenen italienischen paßte.) Schon während der Ouverture wurden die Beziehungen der Personen untereinander in den deutschen Übertiteln diagrammartig dargestellt: mit Pfeilchen und Herzchen und Blitzen. Nach Ansicht Wilds — und/oder Kajtna-Wönigs, wer weiß das schon? — wichtige Wörter wurden in größerer Schrift eingeblendet, solcherart den Lesefluß hemmend. Außerdem konnte man römische Galeeren im Meer » lesen «, es gab ab und zu rote Hintergründe zu sehen. Und nicht zuletzt hatte Wild entschieden, die von Marzio, dem römischen Tribun und Freund Farnaces, gesungenen Textzeilen in römischen Versalien einzublenden. Ach, wie hübsch, denkt man sich. Und: Ach, wie überflüssig.
Kurzum, es gelingt heutzutage selbst in einer semi-konzertanten Aufführung, für übergroße Ablenkung des Publikums vom Wesentlichen zu sorgen: dem Gesang.
V.
Denn gesungen wurde auch. Zwar nur untermittelprächtig, doch was tut das schon zur Sache? Die regulären Leser mögen mir verzeihen: Das Problem der fehlenden Ausbildung der unteren Stimmfamilie (auch bei den Tenören) war an diesem Abend wieder nicht zu überhören. Allen Sängern gebrach es am stimmlichen Fundament. Kaum einmal wollte sich eine Gesangslinie ausbilden. Im Salzburger Besetzungsbüro scheint sich niemand Gedanken betreffend die stimmlichen An- und Herausforderungen der einzelnen Partien zu machen. Hauptsache, der Abend verkauft sich.
Mozart schrieb Mitridate, re di Ponto, den Konventionen der Zeit gemäß für die am Teatro Regio Ducale vorhandenen Sänger und Stimmfächer Sopran (Aspasia, Ismene), Tenor (Mitridate, Marzio), Sopran-Kastrat (Sifare, Arbate) und Alt-Kastrat (Farnace). Die Kastraten sind verschwunden; ihr untauglicher Ersatz durch » Counter-Tenöre « ist geblieben. … Wer Aufnahmen von Alessandro Moreschi gehört und ein Verständnis dafür entwickelt hat, wie kraftvoll ein Männer-Sopran klang, weil er die meiste Zeit mit der Bruststimme sang, wird die meisten heute tourenden Counter-Tenöre (richtiger: Falsettisten) nur um den Preis ertragen wollen, Werke zu hören, die ihm sonst unbekannt blieben.
VI.
Erst nach der Publikation in der Neuen Mozart-Ausgabe wurde das Werk 1971 in den Spielplan der Salzburger Festspiele aufgenommen. Man setzte damals auf die äquivalenten weiblichen Stimmtypen von Sopran und Mezzosopran — allerdings auf Vertreterinnen, welche auch über ein intaktes unteres Register und eine aus diesem erwachsende Farbenvielfalt verfügten: Helen Watts (1971) und Agnes Baltsa (1977).
Paul-Antoine Bénos-Djian stand mit seinem Counter-Tenor als Farnace nur eine eingeschränkte stimmliche Farbpalette zur Verfügung. Im Vergleich zu den vorgenannten Damen klang sein Gesang zu wenig variabel; dabei in den Arien wie auf Dauererregung gestellt. Einige tief liegende Passagen hörten sich an, als hätte der zu den aufregendesten jungen Gesangstalenten unserer Zeit
(so die Salzburger Festspiele marktschreierisch im Programmheft) Zählende sein Brustregister aktiviert. Eine fehlentwickelte Tenorstimme?
VII.
Sara Blanch war eine Aspasia mit luftig geführter Stimme. Sie suchte ihr Heil in den Koloraturen, welche sie mit häufig wechselndem Kehlkopf und ebensolcher Mundstellung sang. Wie schon bei ihrer Wiener Zerbinetta klang die Stimme flach und, spätestens nach der zweiten Arie, uninteressant. Nicht nur Pallid’ombre
verlangte vergeblich nach legato, auch die Rezitative.
Ebenfalls enttäuschend Elsa Dreisig als Sifare. Von Beginn an war ihr Gesang — vor allem in der oberen Mittellage — schwer bis kaum verständlich. Die Stimme: langweilig. Es fehlte an der notwendigen Kompaktheit des Tones (welcher jedoch einer besser entwickelten unteren Lage bedürfte). Kein legato. Dies war besonders in der Arie Lungi da te, mio bene
zu hören: Rob van de Laar entlockte seinem Horn wunderbar geblasene Phrasen, » sang « mit seinem Instrument. Dem hatte Dreisig kaum etwas entgegenzusetzen.
VIII.
Sophie Roset gab eine soubrettige Ismene. Die Stimme der Gewinnerin von Operalia 2023 hörte sich durchwegs klein und eintönig an. Auf Grund der fehlenden Aktivierung der unteren Oktave standen auch Roset nur wenige Stimmfarben zur Verfügung. Vorbei sind die Zeiten, da eine Pilar Lorengar oder eine Ileana Cotrubas als Tochter des Partherkönigs das vom Komponisten intendierte Gegengewicht zur Aspasia bildeten; — vom haushohen Unterschied in der Gesangstechnik ganz zu schweigen.
Iurii Iushkevich sang einen verläßlichen Arbate mit seinem hellen und nicht besonders resonanzreichen Counter-Tenor. Seungwoo Simon Yang erfreute mit seinem Tenor als römischer Tribun Marzio — in den Rezitativen, die besser verständlich waren als jene von Pene Pati. Bei Marzios Arie wurde allerdings rasch hörbar, daß Yangs Stimme vom passaggio aufwärts unzureichend entwickelt ist. Sie klang eng und angestrengt. Die geforderten Höhen wurden nur mühevoll erreicht.
IX.
Pene Pati enttäuschte in der Titelpartie. Nicht nur sein Gesang gab Zeugnis von der ungleichmäßigen Entwicklung seiner Stimme, auch einzelne Phrasen der Rezitative verebbten zu oft im Nichts: Säuseln statt Singen. Vom › g ‹ oberhalb des passaggio an wurde die Verspannung in Patis Stimme mit jeder Sekund größer, die Höhen (nicht nur die › c ‹) klangen durchdringend, doch dabei quäkend. Guglielmo d’Ettore, der Mitridate der Uraufführung, muß über eine sehr gut ausgebildete Höhe verfügt haben: Mozart führte die Tenor-Partie wiederholt bis zum hohen Tenor-› c ‹. Dabei galt in der Regel das › a ‹ über dem passaggio als der höchste Ton, den ein Tenor noch ohne Falsett zu singen hatte.
Pati schrie die Höhen mehr als daß er sie sang; ohne coperto, ohne jede Beachtung der dynamischen Vortragszeichen: In Vado incontro al fato estremo
beispielsweise notierte Mozart auf den Spitzentönen fortepiano. Das hätte man gerne gehört. Auch sonst behielt roher Krafteinsatz zu oft die Oberhand gegenüber den zu Gebote stehenden stimmlichen Mitteln. Der Unterschied zu Peter Schreiers gesanglicher Interpretation des Mitridate 1971: eine Welt.
X.
Ich weiß mich, wieder einmal, einer Minderheit zugehörig.
Doch man ist dazu da, zu sagen, was zu sagen ist.