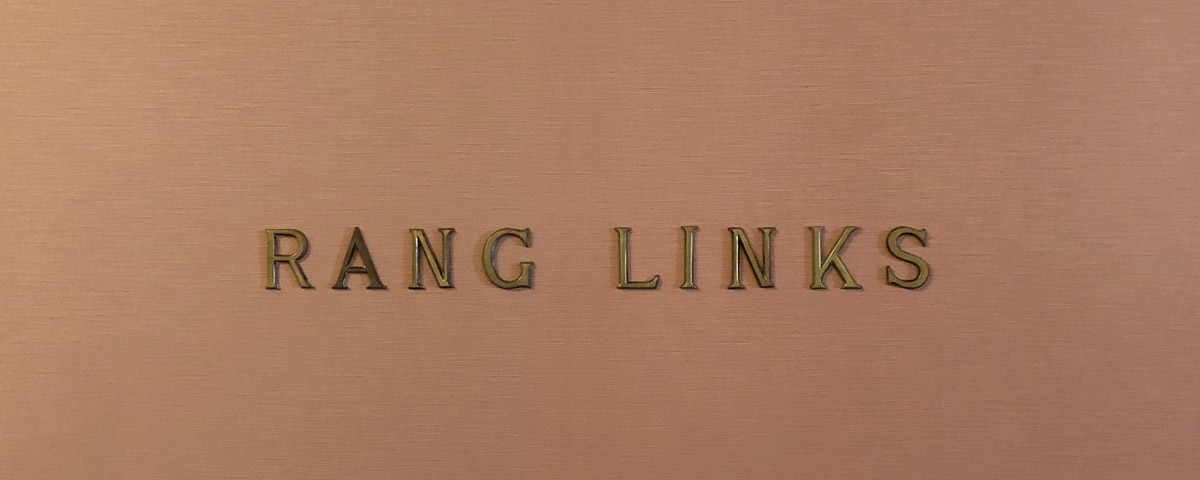
Großes Festspielhaus, Salzburg (Detail).
© Thomas Prochazka
Gedanken zu… »Capriccio« in Dresden
Semperoper Dresden
Von Thomas Prochazka
II.
Das erste Ärgernis ist die minderwertige Tonqualität: In der Klassik spielt sich beim Ton unter einer Datenrate von 192 kbit/s nun einmal nichts ab. In der Folge klingt das als Ouverture gedachte Streichsextett spröde, nicht besser als etwa der Live-Mitschnitt aus der Wiener Staatsoper aus 1964. Überhaupt scheint mir Christian Thielemann, der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, diesmal hinter seinen Möglichkeiten zurückzubleiben: Das klingt alles ein wenig zu gedehnt, zu betulich; zu wenig aufmüpfig, zu wenig spritzig.
Wann immer Thielemann sich dennoch dazu durchringt, das Orchester aufspielen zu lassen, versinken die Sänger in den sich ohnehin niemals türmenden Orchesterwogen. Einzig Camilla Nylund als Gräfin und Georg Zeppenfeld als Theaterdirektor La Roche widerstehen. Die eine mit seit Jahren leider immer schärfer werdender, sich des Fundaments der unteren Stimmfamilie zunehmend begebender Stimme, der andere mit distinguiertem Ton und gutem legato. Wenngleich mir dieser La Roche über weite Strecken zu nobel klingt; zu wenig leidenschaftlich. Die große Szene des Impresarios: Sie wird zum Höhepunkt des Stückes. Es ist das musikalisch-dramatische Glaubensbekenntnis der Autoren Clemens Krauss und Richard Strauss.
III.
Wie Christian Thielemann in einem kurzen Einführungsvideo darlegt, ist Capriccio keine Oper, die sich beim ersten Hören erschließt. Dazu ist der Text zu satirisch und hintergründig, die Anspielungen, (Selbst-)Zitate und Parodien im Orchester zu subtil, folgt die Orchestrierung zu sehr einem parlando-Stil, als daß ein vazierender Besucher es zu bemeistern verstünde. Darum wäre es wichtig, dem Publikum vorzustellen, wovon in der Partitur die Rede, der Gesang geht.
Daß sich einer der führenden Strauss- und Wagner-Dirigenten unserer Tage in seinen Opernproduktionen immer wieder auf die rein musikalische Komponente zurückzieht, anstatt von seinen Partnern bei Neuproduktionen adäquate Besetzungen und, noch viel wichtiger, Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner zu fordern, die das auf die Bühne stellen, was in der Partitur verzeichnet steht, wird mir zunehmendes Ärgernis. Diesen Vorwurf hielte ich auch im persönlichen Gespräch aufrecht.
IV.
Jens-Daniel Herzog scheint nicht daran interessiert, die Partitur zu inszenieren. Wieder einmal erfindet er eine Rahmenhandlung, diesmal mit den gealterten La Roche, Flamand und Olivier. Vergibt nicht nur die erste Szene, die doch Aktuelles aus dem Pariser Musikleben zur Zeit Christoph Willibald Glucks verhandelt, vollständig.
V.
Capriccio ist ein intellektuelles Vergnügen.
Krauss und Strauss siedelten das Werk nicht ohne Grund im französischen Rokoko an. Die Transformation in eine andere Epoche entzieht dem Abend Essentielles: die Diskussion der neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Oper und wie mit ihnen umzugehen wäre. Denn selbstverständlich war der Adel niemals an Jahrhunderte zurückliegenden Ereignissen interessiert, sondern immer an den neuesten Moden (wie der Gluckschen Opernreform). Mit der Verlegung in eine andere Zeit jedoch werden die Referenzen auf Gluck, Rameau und Lully, aber auch Goldoni und Piccini hinfällig.
Dafür entschädigt auch der Druck der »Sixtinischen Madonna« aus der Dresdner Gemäldegalerie im kleinen Zimmerchen der gealterten Madeleine der Rahmenhandlung nicht. Ein sinnloses Detail übrigens, das man im Opernhaus so ohnehin kaum zu sehen bekäme. Ausstattung für die DVD.
Die letzte Szene: Sie bedarf des Spiegels im Salon, darin für uns die doppelte Madeleine sichtbar wird: jene, die Flamand zugetan ist; und die andere, die Olivier liebt. »Frau Gräfin, das Souper ist serviert!«, meldet der Haushofmeister. Es ist der Einbruch der Realität in die Erhabenheit, die ironische Brechung (und Aufhebung) des Thema des Abends: »prima la musica, poi le parole?« Stattdessen bietet der Spielvogt eine Holzvertäfelung und der Gräfin in die Jahre gekommenes alter ego. Es ist ein Jammer…
VI.
In mir keimt (übrigens schon seit Jahren) der furchtbare Verdacht, daß nicht nur in der Oper, sondern auch im Theater all diese Verlegungen in andere Zeit- und soziale Ebenen im Ende auf einer einzigen Ursache fußen: Daß es den Spielvögten an Können und Wissen gebricht.
Der provokante Hinweis des einen oder anderen Intendanten, daß Oper allzuoft zu einem »Konzert in historischen Kostümen« verkomme, ist gewiß leichter im Feuilleton unterzubringen als im eigenen Haus Vorstellung für Vorstellung dafür zu sorgen, daß Floria Tosca bei beiden Besuchen in Sant’Andrea della Valle Handschuhe und Schleier trägt; — wie es 1804 Sitte war. Desgleichen bei Capriccio: Wer Madeleine, Flamand oder Olivier singen will, müßte wissen, wie sich diese Figuren im Paris des 18. Jahrhunderts betrugen. Wie sie gingen, saßen, sprachen. Wie die einzelnen sozialen Schichten miteinander umgingen, sich mischten — und schieden.
VII.
Ein Regisseur, der sein Tun als Berufung begriffe und die von ihm inszenierten Werke ernst nähme, müßte bestrebt sein, den Geist dieser Epochen einzufangen. Einzufangen und uns Heutigen so darzustellen, daß das für uns Wichtige erkennbar, fühlbar wird. Gäbe es nichts mehr, das wir diesen Schöpfungen abzulauschen vermöchten: Die Aufführungen wären Zeit- und Geldverschwendung. Wie — halten zu Gnaden — diese Capriccio-Produktion.