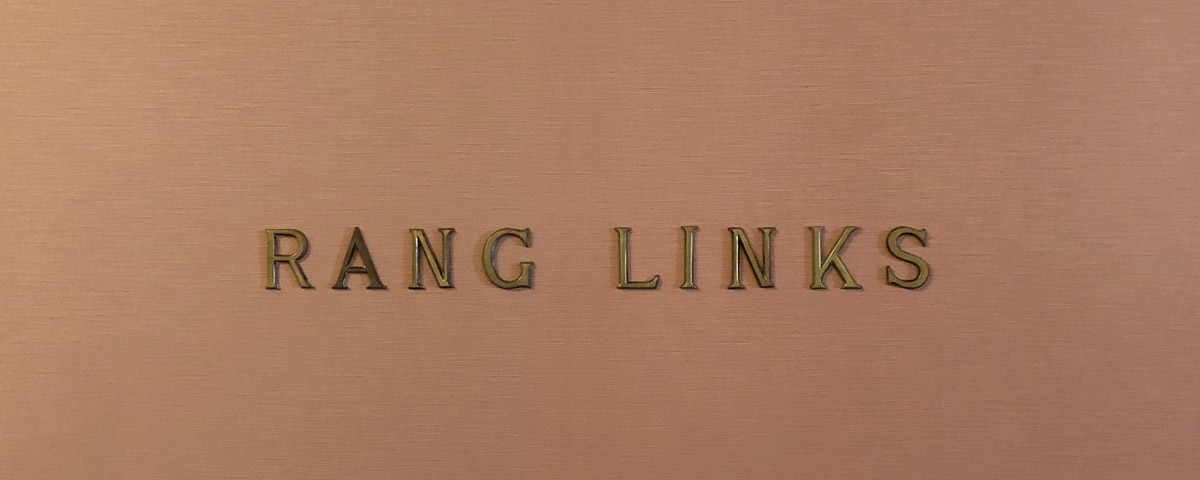
Großes Festspielhaus, Salzburg (Detail).
© Thomas Prochazka
Richard Strauss: » Arabella «
Wiener Staatsoper
Von Thomas Prochazka
II.
Die Lyrische Komödie Arabella, op. 79, zählt zu den weniger beliebten Werken aus Strauss’ Œuvre. Der Partitur gebricht es im zweiten und dritten Aufzug an jener Kompaktheit, welche Hugo von Hofmannsthals unzeitiges Ableben verhinderte. Der Dichter hätte gewiß auf der Erhaltung jener sprachlichen Eigenarten Mandrykas bestanden, welche Strauss tilgte. So kann eines Michael Volle, der in dieser Serie sein Wiener Rollen-Debut gab, keinen Vorwurf machen, daß er sang, was in der Partitur steht: So fließt die stille helle Donau mir am Haus vorbei
. Bei Hofmannsthal heißt es der stille Donau
. Und manches mehr.
Gemeinsam hätte man für eine größere Geschlossenheit gesorgt, Strauss mit Sicherheit von seinem Librettisten noch manche Textstraffung gefordert. Aus der Fiakermilli wäre vermutlich jenes Mannweib in Kanonenstiefeln
1 geworden, dessen reales Vorbild Emilie Turecek (1846 – 1899, seit 1869 verheiratete Demel) war. Clemens Krauss bezeichnete die Fiakermilli als […] eine peinliche Triller-Tante, die entweder zu alt ist oder eine zu kleine, mickrige Soubrette […]
. Das Ergebnis: […] Auf der Bühne mehr oder weniger schönes Gegacker, über das sich der Chor, aber auch nur der Chor, amüsiert.
2 Krauss wünschte sich eine Alternativfassung für einen Mezzosopran vom Typus » Wiener Volkssängerin « anstelle eines — auch diesmal wieder — überforderten Koloratursoprans: Ilia Staple. Zu flach, mit zuwenig Verankerung in der unteren Stimmfamilie klang das, mit unsauber gesungenen Koloraturen. (Eberhard Wächter schrieb mir einmal, einzig Edita Gruberova sei seinem Ermessen nach eine rollendeckende Fiakermilli gewesen.)
III.
Heute spielt man Arabella — mit wenigen Ausnahmen, wie z.B. zu den Salzburger Osterfestspielen 2014 — nicht zuletzt auf Clemens Krauss’ Anregungen hin in einer von Strauss autorisierten, eingestrichenen Fassung mit dem Durchspielen vom zweiten zum Vorspiel des dritten Aufzugs. Dieses findet in der aktuellen Wiener Inszenierung bei offener Bühne und deren Verwandlung vom Fiakerball ins Stadthotel statt: ein weiteres Zeugnis für autorielle Anmaßung (diesfalls des Schauspielers als Spielvogt). Denn wie im Vorspiel zum Rosenkavalier, wenn sogar nicht noch eindringlicher, schildert Strauss die Liebesnacht zwischen Zdenka und Matteo. Vorspiel und Höhepunkt inbegriffen. Auch das war eine Spezialität Strauss’: Die Musik gibt auf den Takt genau an, wann sich der Vorhang wieder zu öffnen habe. (Es gab schon in der Direktionszeit Holender szenisch Minderwertiges.)
IV.
Auffällig auch, daß sich das Staatsopernorchester unter Christian Thielemann diesmal mit tagesabhängiger Leistung präsentierte. Am Mittwoch fein abgestimmt, durchaus sängerfreundlich und in Dynamik und Agogik ausgezeichnet. Drei Tage später rustikal und bar jener Details, welche dem Werk zugute kämen. Schon die ersten Takte gerieten zu laut, zu — lärmend. Zwischendurch allerdings doch viel Schönes, den Wiener Opernalltag Überragendes. Richard Strauss’ kunstgewerblicher Wiener Walzer-Ton liegt Thielemann besser, viel besser als jener ursprüngliche seiner Wiener Namensvettern; weil: mit Gesang versehen und somit ohne die subtilen ritardandi.
Daß bei Thielemann die Sänger über sich hinauswachsen, Leistungen bringen, welche bei anderen Dirigenten gar nicht möglich wären, wissen wir. Doch auch diese Fähigkeit stößt an ihre Grenzen, sodaß die Abende insgesamt wenig mehr als einen befriedigenden Eindruck hinterließen.
V.
Von den drei adeligen Bewerbern Arabellas machte mir der Graf Lamoral des Clemens Unterreiner den besten Eindruck, Gewiß, eine » Wurz’n «, wie Heinz Zednik gesagt haben würde. Doch diese Partien verdienen es, so gesungen zu werden, wie Unterreiner es tat: mit klarer Diktion und legato. Solches kann weder von blaß bleibenden Graf Dominik des Martin Häßler noch von der Heldentenorgelüsten anhängenden Interpretation Norbert Ernsts für den Graf Elemer behauptet werden. Sowohl bei Häßler als auch bei Ernst vermißte ich das Singen auf Linie. Doch auf welchem Humus soll der musikalisch am detailliertesten gezeichnete Nebenbuhler Mandrykas keimen, wenn nicht auf der wienerischen Süße, welche sich nun einmal auf einer gefestigten Gesangslinie gründet?
VI.
Stephanie Maitland als Kartenaufschlägerin und Margaret Plummer als Adelaide entledigten sich ihrer Aufgaben achtbar; nicht mehr. Wolfgang Bankl enttäuschte mich diesmal als Graf Waldner. Das Wienerische dieses Rittermeister a. D. klang viel zu forciert, als daß man es als echt durchgehen lassen könnte. Da war man von Bankl aus der Vergangenheit Besseres gewohnt.
VII.
Michael Laurenz mühte sich hörbar mit der Partie des Matteo. Durchwegs das Gesicht dem Publikum (oder dem Dirigenten) zugewandt, verfestigte sich in mir jener Hilfe heischende Eindruck, von dem in Arabellas großer Szene im Finale des ersten Aufzuges die Rede geht. Was sollen mir — von Strauss durchwegs prominent gesetzte — hohe Tenor-› b ‹, wenn sie mit dünner Stimme gesungen werden? Was eine Tenorstimme, die sich über dem passaggio hörbar verengt, unfrei und angestrengt anhört? Laurenz’ Matteo nahm man halt so hin, als etwas zweifelhafte Existenz.
Ich weiß nicht, wer den Sabine Devieilhe vorauseilenden Ruf in die Welt setzte. Gerecht wurde sie ihm bislang nicht; zumindest nicht in den Partien der Sœur Angelica und nun der Zdenka, in welchen ich die Sängerin live hörte. Devieilhes Instruments Zentrum findet sich, wie jenes vieler ihrer Kolleginnen, in der oberen Oktave. Die untere ist zuwenig durch- und — wie auch bei Ilia Staple — ausgebildet, als daß sich eine korrekte tonale Balance einstellte. Als Folge stehen Devieilhe nur wenige Stimmfarben zur Verfügung. Die Höhen klangen flach, die Stimme klein. Textundeutlichkeit war die Folge. Am Mittwoch versank das Ende mancher Phrase in den (ohnehin stark gezügelten) Orchesterwogen. Am besten gelang dieser Zdenka der dritte Aufzug. Erst da schien mir Devieilhes Gesang freier.
VIII.
Auch an Camilla Nylunds Stimme, einst eine gern gehörte Arabella, hinterließ die Zeit ihre Wunden. Nylunds Gesangsleistung scheint mir bereits stark Tagesschwankungen zu unterliegen. Besonders am Mittwoch (16. April), teilweise auch in der dritten Vorstellung ließ diese Arabella bei jedem länger zu haltenden Ton jenes langsame und störende Vibrato hören, welches auf fortgesetzte Überbeanspruchung eines Instrumentes hinweist. Dieses Vibrato wurde mit Fortdauer des Abends, wenn sich Ermüdungserscheinungen einstellten, stärker.
Camilla Nylund forderte ihrem (eigentlich) lyrischen Sopran in den letzten Jahren Salomes, Sentas und Brünnhilden ab. Die Folge: Ihr Instrument läßt sich in Momenten großer Spannung und in lauteren Passagen nur mehr schwer kontrollieren, die — auch bei Nylund nicht in wünschenswertem Maße vorhandene — Verbindung der beiden Stimmfamilien wird loser, die piani tragen nicht mehr. Deutlich zu hören war dies vor allem bei Abstiegen ins Brustregister und in jenen Momenten im Finale des ersten und im dritten Aufzug, welche in den oberen Regionen nach größerer Stimmkraft verlangen. Der Vorteil dieser Arabella: Thielemann und sie kennen einander sehr gut, sind aufeinander eingespielt. Der Kapellmeister ahnt, welcher Unterstützung Nylund im nächsten Takt bedürfen wird.
IX.
Michael Volle: mehr Wotan auf Wien-Besuch denn slawonischer Edelmann auf Brautschau in — zumindest laut Libretto — dem Kaiser seine[r] Hauptstadt
. Jeder Zoll kein Mandryka; auch im Spiel. So linkisch agiert kein Großgrundbesitzer, der gewohnt ist zu befehlen — selbst wenn er sich der für ihn ungewohnten Umgebung der Kaiserstadt gegenübersieht. Leider blieb dieser Mandryka auch gesanglich vieles schuldig. Immer wieder hauchte Volle Anfangssilben, anstatt sie piano zu singen. Strauss ist nun einmal nicht Wagner: Er verlangt auch in seinen späteren Opern die fortgesetzte Anwendung des legato, des Singens auf Linie. Bei Volle: nicht. Immer wieder mußte er nach zwei, drei Wörtern unterbrechen, um zu atmen. Strauss im Wagner-Gesangskleid unserer Tage. (Man höre sich Josef Metternich in der Partie des Mandryka an.)
X.
Diese Arabella: eine Wiederbegegnung der schmerzlichen Art.
- Brief von Richard Strauss an Clemens Krauss vom 25. März 1942, erstmals publiziert in: Sabine Kurth: » Grundlegendes läßt sich kaum mehr ändern «. Eine Studie zu zwei Autographen betreffend den Auftritt der » Fiakermilli « in der Lyrischen Komödie » Arabella «, op. 79, Richard Strauss-Blätter, Neue Folge, Heft 25, S. 63ff, Wien 1991, ISBN 3-7952-0671-5, sowie in: Strauss, Richard: » Briefwechsel / Richard Strauss — Clemens Krauss «, herausgegeben von Günter Brosche, Verlag Schneider, Tutzing, 1997, ISBN 3-7952-0916-1 ↵
- Brief von Clemens Krauss an Richard Strauss vom 24. März 1942, ebd. ↵