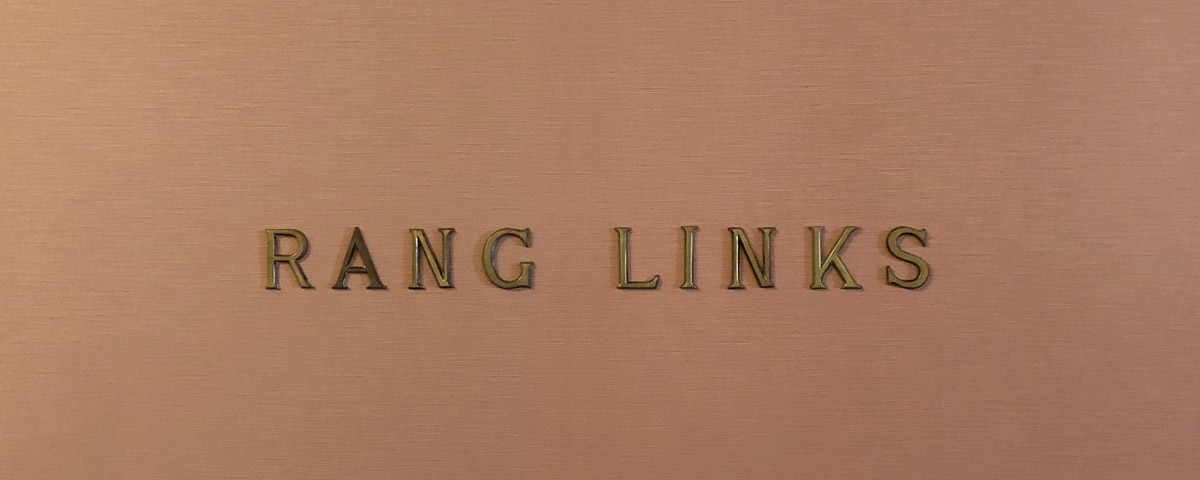
Großes Festspielhaus, Salzburg (Detail).
© Thomas Prochazka
Gedanken zu… »Der Rosenkavalier« in München
Bayerische Staatsoper, München
Von Thomas Prochazka
II.
In München wird solches Tun, das immerhin unter der Schirmherrschaft von Strauss’ langjährigem Partner Boosey & Hawkes vonstatten geht, mit den Notwendigkeiten von »Sie wissen eh« argumentiert. Eberhard Kloke schreibt, er wollte »eine klangliche Lösung für ein Konversationsstück […] finden«. Auch sei es ihm »um eine Veränderung des Klangbildes und damit der Klangstruktur innerhalb des Orchesters sowie der Balance zwischen Bühne und Orchester« gegangen. Als bestünde irgendeine Notwendigkeit, Richard Strauss’ großartige Instrumentation verbessern zu müssen. Um den Komponisten selbst zu zitieren: »Wann i net wollen hätt, daß man’s spielt, hätt’ i’s net komponiert.«
Kloke argumentiert mit weiteren Vorteilen (und kommt damit der eigentlichen Wahrheit gefährlich nahe): »Im Vordergrund stehen besetzungstechnische Vorteile durch variable Besetzungsalternativen im Hinblick auf schlankere Stimmen. Das kommt wiederum der Textverständlichkeit und Transparenz zugute und entspricht damit auch grundsätzlich der musik-theatralischen Anlage des Stückes als Konversationsstück.«1
Wie konnten wir, das Publikum, uns nur 110 Jahre lang so von Dirigenten und Musikwissenschaftlern an der Nase herumführen lassen? Wie konnten wir übersehen, daß Der Rosenkavalier ein »Konversationsstück« ist? (Höchstwahrscheinlich ebenso wie die Salome.) Was Kloke mit »schlanken Stimmen« bezeichnet, nannte man früher übrigens schlechte Sänger. Man suchte sich bessere — so man sie sich als Operndirektor leisten konnte —, und die Welt drehte sich weiter. So einfach war das.
III.
Barrie Koskys zentrales Thema ist die Zeit. Das ist zwar nicht das zentrale Thema der Oper, doch was tut das schon zur Sache? So gibt es alle Arten von Uhren. Sogar Schwager Kronos tritt auf. Ihn sucht man zwar in Hofmannsthals und Strauss’ Personenverzeichnis vergeblich, doch dafür gehen einige der 13 Schläge der Uhr in der Marschallin Schlafzimmer im Orchesterrauschen unter. Ausgleichende Gerechtigkeit…
Allerdings: Ist das zentrale Thema im Rosenkavalier nicht vielmehr die Liebe (oder, besser: die Lust) in all ihren Spielarten? Der schwärmerische Jüngling, die mit ihren 35 Jahren auch noch junge Feldmarschallin Fürstin Werdenberg, die halbwüchsige Sophie, der seiner Lust lebende Landedelmann Baron Ochs auf Lerchenau… Ist es nicht die Ironie des Stückes, daß nach dem Fallen des Vorhangs alle weiter tun werden wie bisher? Der Lerchenauer wird weiterhin hinter dem Gesinde her sein. Die Feldmarschallin wird sich binnen Wochen mit einem anderen Jüngling trösten: »Einmal…« Und die Jungen? Sophie wird über kurz oder lang zur neuen Marschallin werden…
IV.
Regieanweisungen sind, so scheint’s, Barrie Kosky herzlich gleichgültig, wenn es darum geht, einem Werk seine übersprudelnden Phantasien und unzähligen Ideen überzustülpen. Immer wieder stolpert man über Schlüpfrigkeiten, welche vielen seiner Produktionen gemein sind: Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt.
Aber wer liest denn heute noch das Kleingedruckte? Hätten’s die Verantwortlichen gelesen, es wäre ihnen nicht entgangen, daß in Richard Strauss’ Partitur für Ort und Zeit der Handlung »In Wien, in den ersten Jahren der Regierung Maria Theresias« geschrieben steht. Hugo von Hofmannsthal schuf eine Kunstsprache, die es so natürlich im Rokoko nie gegeben hat. Die sich jedoch, wie jetzt in München, jeder szenischen Aktualisierung erfolgreich widersetzt. So wirkt es nur mehr albern, wenn der Baron Ochs im Anzug und die Feldmarschallin im 1920-er-Jahre-Abendkleid eingewienerte italienische und französische Redewendungen verwenden.
Diese Inkongruenz setzt sich im unglaubwürdigen Verhalten der Personen und ihren Kostümen (Victoria Behr) fort: Octavian auf der Sofalehne sitzend, während die an ihn geschmiegte Feldmarschallin mit dem Ochs »parliert«? Seit wann trägt man Degen zum Smoking (mit ausgestellter Marlene Dietrich-Hose)? Die Feldmarschallin, die nach dem Frühstück das Abendkleid im Stil der 1920-er Jahre anlegt, um damit »in die Kirch’n« zu gehen? Sophie, die im Cocktailkleid in ihrem Bett herumturnt?
V.
Auch sonst ging handwerklich einiges daneben: Wenn man die Livree hinten in die Kutsche einsteigen sieht, nur damit sie auf der vorderen Seite wieder herausklettert, verliert man das Vertrauen in die Handwerkskünste des Arrangeurs. Und was, bitte, soll das Herumgeturne von Octavian und der Marschallin im ersten Aufzug, während anstelle des Frühstücks, wie’s in der Partitur steht — und komponiert wurde! — Kübelpflanzen auf die fast dunkle Bühne gerollt werden? (Übrigens in völliger Ignoranz der Spielanweisung, wonach der erste Aufzug im Schlafzimmer der Feldmarschallin spielt.) Fiel denn niemandem auf, daß der Friseur an diesem Morgen nicht erschienen war, der Feldmarschallin Klage daher ins Leere lief? Einzig Galeano Salas als Sänger im an Ludwig XIV. gemahnenden Kostüm war wenigstens eine Augenweide…
VI.
Vladimir Jurowski, der designierte Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, ergab sich bereits vor Amtsantritt: Es scheint kaum vorstellbar, daß er nicht weiß, daß Strauss sowohl die Frühstücksszene als auch den Auftritt des kleinen Mohammed minutiös in der Partitur schildert. Nicht nur hier wäre Widerstand zu leisten gewesen gegenüber den Begehrlichkeiten des Spielvogtes.
Auch gegen die Klokesche Fassung wäre bis zuletzt Einspruch zu erheben gewesen, die sich erschreckend weit vom Original angesiedelt anhörte. Die in keinem Moment jene musikalische Farbenpracht des Orchesters der Ariadne auf Naxos erreichte. Dabei weiß man ja in München sehr gut, wie man Richard Strauss spielt. Daß man derzeit ein bisserl aus der Übung zu sein scheint, war nicht nur beim Violinsolo im Finale des ersten Aufzuges zu hören: Ein wenig anämisch klang das alles; leidenschaftslos; eintönig. (’S wär’ hoch an der Zeit, daß die Theater wieder spielen.)
VII.
Marlis Petersen wird wohl all die nächsten Jahre die Feldmarschallin Fürstin Werdenberg in München geben. Denn kaum eine andere Interpretin dieser Partie wird es sich angelegen sein lassen, in des Spielvogt Kosky freizügiger Inszenierung mit Octavian noch vor dem Frühstück zwischen den Kübelpflanzen Fangerl zu spielen… Petersen singt die Feldmarschallin mit flacher Stimme. Säuselt oft, ohne Tiefe. Man will sich gar nicht ausmalen, wie sie forcieren wird müssen, sollte man nach »Sie wissen eh« wieder zur originalen Orchesterbesetzung zurückkehren. Petersen bot eine gesanglich uninteressante Darbietung, weit entfernt vom Strauss’schen »Silberton« der Großen der Vergangenheit. Jene mögen uns entschwunden sein; doch schmälert das weder ihre Leistungen noch macht es die Tatsache ungeschehen, daß sie über eine viel bessere Gesangstechnik verfügten: Wer kritisch dergleichen billigt, ist ein Niveau-Schänder.
Um den Octavian der Samantha Hankey war es nicht viel besser bestellt: Zweiter Preis beim Operalia-Wettbewerb 2018 hin oder her, gesangstechnische Mängel bleiben gesangstechnische Mängel. Hankey verfügt über schönes Material, weiß auch die untere Stimmfamilie einzusetzen. Allerdings läßt ihre Stimme bereits jetzt, falscher Technik geschuldet, ein übergroßes Vibrato hören. Man achte auf die Zungenstellung und den (zu) weit geöffneten Mund: Vergeudung der Kräfte, wohin man blickt.
Katharina Konradi hinterließ mir als Sophie einen günstigeren Eindruck als noch vor einigen Wochen bei ihrem Abend mit Schubert-Liedern. Aber auch ihr fehlt es an jener Körperspannung, die doch die Grundlage bildet für die notwendige Komprimierung des Tons über den gesamten Stimmumfang. Operngesang ist Schwerarbeit.
Und Christof Fischesser, der Baron Ochs auf Lerchenau? Auch der mühte sich nach Kräften — ich will’s ja niemandem absprechen —, aber mehr als ein »Oxerl« wurd’ es nicht. Zu farblos, zuwenig eindringlich hörte sich das für mich an. Und ohne ein sauberes tiefes ›e‹ im Finale des zweiten Aufzuges bleibt es halt nur eine halberte G’schicht’. Gewiß, nett, daß man den Strich im ersten Aufzug geöffnet hatte, somit einmal die gesamte Lerchenauische Tirade zu hören bekam. Doch macht das schon einen Ochs?
VIII.
München bekam mit dieser Produktion eine Stagione-Inszenierung, die sich im Repertoire bewähren soll. Das wird, fürchte ich, nicht funktionieren. Im mindesten nicht, was den Kassenreport betrifft. Betrüblich stimmt, daß auch die musikalische Seite dieses Nachmittages nicht überzeugte.
(Man ist dazu da, die Wahrheit zu sagen.)
- Richard Strauss: »Der Rosenkavalier«, op. 59. Komödie für Musik in drei Aufzügen von Hugo von Hofmannsthal. Transkription für Soli, Chor ad lib. und mittelgroßes Orchester op. 90 von Eberhard Kloke auf musikakzente.de. ↵