
Deckengemälde von Marc Chagall im Pariser Palais Garnier (Ausschnitt)
© Thomas Prochazka
Die Oper — Kritische Zeit für eine Kunstform? (III)
Von Thomas Prochazka
II.
In seinem 2018 erschienenen Buch »Opera as Opera« fordert Conrad L. Osborne eine Abkehr vom Primat der Regisseure. Und die Wiedereinsetzung des Rechts der Stimmen und der Musik. Osborne tut dies in der Überzeugung, daß Oper eine durch das Ohr geführte, vom Auge bestätigte Kunstform ist.1
Er nimmt damit denselben Standpunkt ein wie Thomas Hampson. Hampson ist ebenfalls der Ansicht, die Oper sei eine musikalische Kunstform; und keine theatralische.2
III.
Was genau ist »Oper«? Der Brockhaus, Merriam-Webster und Wikipedia halten Definitionen bereit — welche den Kern nicht treffen. Oper ist nicht Theater; — und damit auch nicht Musiktheater, wie es vor allem von den Vertretern des »Regietheaters« (um diesen wenig passenden und doch eingeführten Begriff zu verwenden) und den vielfach vom Schauspiel abgewanderten und in musikalischen Dingen unbewanderten Regisseuren und Intendanten marktschreierisch angepriesen wird.
Was sollten sie sonst auch tun, die Gürbacas und Liedtkes, die Warlikowskis, Wielers und Morabitos, die Guths, Homokis, Laufenbergs und Loys? Sie bringen ja nicht anderes zuwege, als die großen Werke des Kanons auf immer nur einen Aspekt, eine gerade aktuelle zeitgeistige Strömung, zu reduzieren. Keck beanspruchen sie die Autorenschaft an den Meisterwerken (zumeist des »E-19«3), wo ihnen doch nur die Rolle des Interpreters frommt. Aber mit ihren an der musikalischen Seite der Angelegenheit nicht interessiert scheinenden Komplizen in den Intendantensesseln haben sie längst schon den Widerstand der Dirigenten gebrochen.
Das Ergebnis erleben wir tagaus, tagein in unseren Opernhäusern: Dirigenten, die aufgehört haben, sich für die Partitur und ihre Eintragungen als einzig geltende Richtschnur stark zu machen. Die die Sänger nicht länger davor schützen, schauspielerische Aktionen durchführen zu müssen, welche die musikalische Interpretation behindern oder verunmöglichen. Die sich einreden, so lange nicht in die Musik eingegriffen würde, sei alles nicht so schlimm.
So landen wir beim »Musiktheater«, vom Feuilleton in seiner Langeweile bejubelt und von jenem Teil des Publikums gefordert, der »Neues« erleben will. Und doch die Meisterwerke des »E-19« noch lange nicht in ihren musikalischen Strukturen zu entschlüsseln vermochte. Die Folge: Intendanten kommissionieren Werke wie Die Weiden. Werke, deren einziger Wert darin besteht, uns den Begriff »Musiktheater« vor Augen zu führen. Indem nämlich die Komposition des Schauspiels bedarf, weil die musikalische Substanz zu schwach ist, um den Abend zu tragen; geschweige denn für sich allein zu bestehen.
IV.
Doch (schreckliche Wahrheit auch dies): Oper ist nicht Musiktheater.
»Oper«, führt Conrad L. Osborne aus, »ist Theater durch Gesang. Ihre theatralische Form ist das Drama, das Theater des Konflikts. […] Die Grundlage des Ausdrucks in der Oper ist das gesungene Wort, welches seinen eigenen Inhalt besitzt, während es diesen zugleich mit Hilfe musikalischer Mittel überhöht. Sein zentraler Interpret ist der Sängerdarsteller, der den Charakteren des Dramas Ausdruck verleiht und der allein das gesungene Wort zum Leben erwecken kann. […] Oper ist keine Mixtur aus anderen Formen, sondern nur sie selbst: Oper als Oper.«4
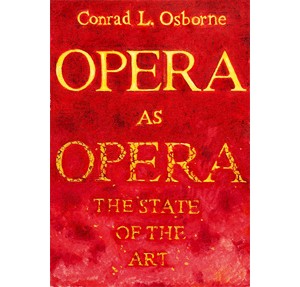
Conrad L. Osborne
»Opera as Opera. The State of the Art«
Englische Ausgabe
Proposito Press, 2018; Hardcover, 840 Seiten.
ISBN: 9780999436608
Preis: USD 45,–
Erhältlich via www.conradlosborne.com
Osborne redet also den Konzerten in Kostümen ebensowenig das Wort wie dem von den Spielvögten beanspruchten Recht auf Autorenschaft und dem Vorrecht der Szene. Er führt den Begriff des Sängerdarstellers ein. Und ist doch unglücklich über den Begriff »singeractor«. Denn Osborne weiß zu gut, daß dieser mit der — falschen — Bezeichnung des »Singschauspielers« gleichgesetzt werden wird.
V.
Um uns für die Oper zu interessieren, zu begeistern und zu erregen, bedarf es der Sänger. Der Sänger, welche uns die im Text enthaltenen Emotionen mit ihrer Stimme nahebringen. Die mit ihrer Stimme zu spielen vermögen. (Osborne findet dafür den Begriff »acting with the voice«.) Und er meint nicht jene als »Singschauspieler« Apostrophierten und Gefeierten, welchen die vokale Seite gleichgültig ist, solange sie nur schauspielerische Akzente setzen können. Deren Gesangskunst zur zufriedenstellenden Darstellung ihrer Partie nicht ausreicht. Und die daher, angespornt von den Autorenschaft beanspruchenden Spielvögten, ihre vokalen Unzulänglichkeiten mit Schauspiel zu übertünchen suchen.
Da liegt immer ein Spagat beim Sängerschauspieler, […] daß man versucht, die Intensität der Figur ins Schauspiel zu legen und nicht in die Stimme.
Marlies Petersen in der Vorschau zur Salome-Produktion der Bayerischen Staatsoper, 18. März 2018
»Man muß auch eine Balance finden zwischen gesundem Singen und großem Ausdruck. Und ja, da liegt immer ein Spagat beim Sängerschauspieler, daß man irgendwie sich nicht verschreit daran, sondern daß man versucht, die Intensität der Figur ins Schauspiel zu legen und nicht in die Stimme«, ließ Marlis Petersen während der Vorbereitung der Salome-Neuproduktion in München wissen. — Sie weiß vielleicht gar nicht, wie unrecht sie hat. Denn selbstverständlich gilt in der Oper das Primat der Musik und damit der an erster Stelle stehenden gesanglichen Interpretation einer Partie. Die »vokale Geste« muß die Quelle allen Opernspiels sein.
VI.
Das Ziel ist die Einheit von gesanglicher und schauspielerischer Darstellung. Doch wird die stimmliche Komponente zu oft der darstellerischen geopfert. Dies nicht zuletzt, da es vielen Sängern an den notwendigen gesangstechnischen Fertigkeiten zur Beherrschung ihrer Partien gebricht.
Das wird — unter anderem — aus der beiläufigen Behandlung der Rezitative deutlich. Dabei sind es diese, welche die Handlung vorantreiben. Rezitative gehören zum schwierigsten überhaupt. Sie verraten alles über eines Sängers Durchdringungsvermögen seiner Partie; seine Beherrschung der Sprache, kurzum: seine Meisterschaft. Denn ohne die Gestaltung des (vorbereitenden) Rezitativs wird die nachfolgende Arie sinnlos.
Ein Beispiel: »Hai già vinto la causa!«, das Rezitativ des Conte di Almaviva im dritten Akt von Mozarts Le nozze di Figaro. Joyce DiDonato beschrieb die Verfassung des Conte in einer Meisterklasse einmal unter dem Lachen des Publikums: »Antonio, der Gärtner, ist Dein Vertrauter in dieser Oper? Was? Wie konnte das passieren? … Der betrunkene Gärtner? Du gehst zu ihm, um Rat zu erhalten? — Das ist nicht Dein bester Tag…«5
In diesem Rezitativ durchläuft der Gemütszustand des Conte di Almaviva die Kurve von bassem Erstaunen bis zum Zorn darüber, daß er von Susanna hereingelegt wurde. Er muß erkennen, daß die Braut seines Untergebenen niemals im Sinn hatte, ihm jenes erotische Abenteuer zu gewähren, dessen er sich noch im Gespräch mit ihr so sicher wähnte. Und welches ihm seiner Meinung nach — Le nozze di Figaro spielt am Vorabend der Französischen Revolution — als Adeliger und Herr zusteht. Diesen Sinneswandel darzustellen, lautet die Aufgabe. Da der Conte di Almaviva allein auf der Bühne steht, muß der Sänger durch die stimmliche Gestaltung der Szene dafür sorgen, seine Reaktion dem Publikum nicht nur durch die Deklamation des Textes anschaulich zu machen.
Wird des Conte Seelenzustand für das Publikum nicht erfühlbar, nicht nachvollziehbar, gerät der Abend lang(weilig). Aber auch die darauffolgende Arie »Vedro, mentr’io sospiro« bedarf der Gestaltung. Und da die Arie immer ein retardierendes Moment ist, bleibt dem Sänger als einzige Möglichkeit das »Spielen mit der Stimme«. (Denn für gewöhnlich lassen einen die hochgelobten Spielvögte in dieser Situation allein.)
Der gute Sänger (der »Sängerdarsteller« im Osborne’schen Sinn) tritt interpretatives Terrain an die Autoren — Librettist und Komponist — ab. Er tut dies jedoch mit dem Wissen um den Gewinn ungeahnter Ausdrucksmöglichkeiten im Bereich des Tonfalls und der Intonation. Gesang ermöglicht nicht nur einen größeren Tonumfang als das gesprochene Wort, sondern auch das Aushalten langer Notenwerte. (Etwas, das viele Sänger fälschlicherweise auch in den Rezitativen so handhaben. Dort soll jedoch der deklamatorische, gesprochene Ton vorherrschen.6)
VII.
Als Beispiel gelungenen Spielens mit der Stimme diene Zoryana Kushplers Darstellung der Madelon in Giordanos Andrea Chénier im April 2018 an der Wiener Staatsoper. Man spielt in Wien »nach einer Regie von Otto Schenk« — in den Augen vieler »Neues« und »interessantes Musiktheater« Fordernden ein »Konzert in Kostümen«; — und damit ein Affront. Kushpler belehrte jedoch alle, die zuhören wollten, eines besseren: Da stand sie, als alte und blinde Madelon, und erzählte die Geschichte vom Tod ihres Sohnes in den Wirren der Revolution; nahm Abschied von ihrem Enkelkind. Kushpler, wiewohl technisch nicht perfekt, erweckte die Figur der Madelon allein durch ihren Gesang zum Leben. Bewegte. Ergriff. Einer der stärksten Eindrücke der vergangenen Spielzeiten. Und Beweis, daß man, um Oper zu spielen, der Sänger bedarf. (Und nicht der Spielvögte.)
VIII.
Das »Spielen mit der Stimme«, das Erzählen der Geschichte durch Gesang ist im Ende die einzige Versicherung eines Sängers, auch mit schlechten Regisseuren zurechtzukommen. (Und deren gibt es viele an unseren Opernhäusern. Zuviele.) Oder bei Vorsingen. Ganz besonders in diesen Fällen hilft das genaue Wissen um die seelische Verfassung der Person, welche es den — zumeist wenig von Stimmen verstehenden — Intendanten vorzustellen gilt. Und die Fertigkeit, mit der Stimme die jeweilige Situation interessant zu gestalten.
IX.
Oper muß spannend sein. Aufregend. Emotionsgeladen.
Doch dazu bedarf es gut ausgebildeter Sänger mit dem entsprechenden technischen Rüstzeug. Ein paar live aufgenommene Beispiele zeigen, wie aufregend, wie spannend, wie toll Oper sein kann: Wie Franco Corelli sein »Vittoria« ausreizt. Wie Giuseppe di Stefano als Edgardo 1954 seiner Lucia »Maledetto sia l’stante« entgegenschleudert; wie spannend, wie mitreißend diese Szene sängerisch gestaltet werden kann! Hört man solches, ermißt man erst, wie stimmlich anämisch, wie gesanglich uninteressant die Premièren-Serie der aktuellen Wiener Produktion wirklich war.
X.
Wer die Kunstform Oper im 21. Jahrhundert lebendig erhalten und neuen Publikumsschichten erschließen will, sollte sich des Wichtigsten versichern: der am besten ausgebildeten Sänger. Jener, welche über die erforderliche Stimmtechnik und darüberhinaus die notwendige gesangliche Intensität verfügen: über die Fertigkeit des Spielens mit der Stimme.
- Osborne verwendet dafür die Bezeichnung »ear-led, eye-confirmed«. ↵
- »Opera is a musical art form. It is not a theatrical art form.« Thomas Hampson am 16. Feber 2015 in einer Meisterklasse an der Manhattan School of Music. ↵
- Osborne bezeichnet mit dem Begriff »E-19« das erweiterte 19. Jahrhundert, also die Zeitspanne von Mozart bis Richard Strauss. ↵
- »Opera is theatre through song. Its theatrical form is drama, the theatre of conflict. […] Opera’s basic unit of expression is the vocalized wordnote, which embraces its own verbal content while transcending it by musical means. Its central interpreter is the singeractor, who embodies the drama’s characters, and can alone vitalize the wordnotes. […] Opera is not an amalgam of other forms, but only itself: opera as opera.« Conrad L. Osborne: »Opera as Opera. The State of the Art«, Proposito Press, 2018, ISBN 9780999436608; S. 31↵
- »Antonio, the gardener, is your confidant in this opera? What? How did that happen? … The drunk gardener? You are going to him to get advice? — This is not your best day…« Joyce DiDonato am 5. November 2013 in einer Meisterklasse an der Juilliard School. ↵
- Jean-Jacques Rousseau bemerkte 1757: »Das beste Recitativ singt am wenigsten. Es muß Sprache sein … ist (leider) oft Gesang.« Daniel Gottlob Türk ließ 1787 wissen: »Die Recitative sollen nie nach Tact gesungen werden, wenn nicht a tempo dabey steht. Taktschlagen bei den erzählenden Recitativen … ist eine höchst alberne Angewohnheit … und verrät große Unwissenheit […]« Und Carl Maria von Weber schrieb in seiner Oper Der Freischütz ›Recitativo‹ sogar als Vortragsbezeichnung vor. ↵